Listeners:
Top listeners:
-
play_arrow
Lemgo Radio Der Sound für Lemgo
-
play_arrow
Eichsfeld Welle Regionalradio für den Landkreis Eichsfeld
-
play_arrow
Sound-Phoenix Regionalradio für Drebber
-
play_arrow
FLR1 Regionalradio für Witten
-
play_arrow
SchlagerMax 100% Schlager

Ein Triumph der Stimme – Und des Unbehagens
Es hätte ein Fest der Musik sein sollen: Der Eurovision Song Contest 2025 lockte am gestern (17. Mai 2025) Millionen Zuschauer vor die Bildschirme. Einige feierten private Parties, andere saßen allein gebannt vor TV oder PC.
Schauplatz war dieses Jahr die St. Jakobshalle in Basel, Schweiz – eine Bühne, die wieder einmal zum Brennpunkt kultureller und politischer Spannungen wurde.
Den musikalischen Höhepunkt lieferte am Ende der Österreicher JJ mit seiner epischen Fusion aus Oper und Elektronik. Sein Song „Wasted Love“ überzeugte die Jury klar und holte auch im Televoting solide Punkte – das Resultat: Platz 1 mit 436 Punkten. Ein verdienter Sieg, technisch wie stimmlich. Doch dieser künstlerische Erfolg wurde am Ende von ganz anderen Fragen überlagert: Wie politisch darf ein Musikfestival eigentlich sein? Und wo endet der Spaß, wenn vor der Halle Tränengas in der Luft liegt?
Deutschland auf Platz 15 – „Baller“ trifft nicht ins Schwarze
Für Deutschland trat das österreichische Duo Abor & Tynna mit dem Song „Baller“ an. Energiegeladen, poppig, radiotauglich – aber im internationalen Vergleich trotz des Lobes von vielen Influencern und Experten offenbar doch zu glatt. Mit 151 Punkten landeten sie schließlich frühzeitig auf Rang 15.
Zwar ist das ein wirklicher Achtungserfolg, aber eben kein Durchbruch im Vergleich zum letzten Jahr (Platz 12 für Isaak). Kritiker lobten die Produktion, warfen dem Auftritt aber fehlende Kante und Identität vor. Stefan Raab, der als Mentor mitwirkte, zeigte sich enttäuscht, übernahm die Verantwortung, verteidigte jedoch die Künstler.
Einziger Trost: Die Zuschauer in der Ukraine und Tschechien zückten immerhin die begehrten 12 Punkte – ausgerechnet zwei Länder, in denen der politische Ton zuletzt oft rau war. Ob das am Lied lag oder an der Symbolik des Titels?
Latex, Lachnummern und Länderverwirrung – Der skurrile Rest
Was wäre der ESC ohne Anekdoten? 2025 bot davon reichlich – nicht immer im positiven Sinne.
- Finnland: Erika Vikman sorgte mit ihrem Song „Ich komme“ für eine Latex-Provokation. Diese endete auf einem schwebenden, goldenen Mikrofon. Ist das noch Kunst oder schon Kitsch? Das Publikum war gespalten. Und sogar der finnische Präsident Alexander Stubb distanzierte sich öffentlich von dem Beitrag. Platz 11.
- Malta: Der Songtitel „Kant“ (malerisch „Gesang“) musste vor den Shows wegen unglücklicher englischer Assoziationen („cunt“ = Nutte) kurzfristig in „Serving“ geändert werden. Ein PR-Desaster – aber immerhin war es ein viraler Hit in sozialen Netzwerken. Platz 17.
- Vereinigtes Königreich: Das Trio Remember Monday bekam exakt null Punkte im Televoting. Schon zum zweiten Mal. Die britische Presse sprach von einer „humiliating tradition“ (erniedrigende Tradition). Platz 19.
- Schweden: Favoritenstatus? Ja. Siegesreife? Nein. Der spaßige Sauna-Song „Bara Bada Bastu“ wurde zur Enttäuschung wegen der Gesangsperformance und wurde so zur Meme-Vorlage – aber nicht zum ESC-Triumph. Trotzdem Platz 4.
- Estland & Australien: Ästhetisch waren beide Beiträge stark, inhaltlich relativ leergetrunken – beide Länder präsentierten visuell beeindruckende Shows und ironische Songs. Australien schaffte es trotz sehr guter Performance im Halbfinale nicht ins Finale. Estland überzeugte zwar, beide Beiträge wurden aber von Jurys und Zuschauern als „kalt“ empfunden.
Kurzum: Die Bühne war groß, viele Beiträge verloren sich aber im Blend- und Bildwerk.
Wenn Musik zur Nebensache wird: Israels Teilnahme im Tornado der Kritik
Nie war ein Teilnehmerland derart umkämpft wie Israel zumindest in den letzten Jahren. Die Sängerin Yuval Raphael, eine Überlebende des Hamas-Angriffs vom 7. Oktober 2023, trat mit der Botschaft „New Day Will Rise“ an – musikalisch solide, aber emotional und zwischen den Zeilen politisch aufgeladen.
Die Realität in der Halle sprach letztlich eine andere Sprache: Buhrufe, Pfiffe und Versuche, die Bühne während ihres Auftritts zu stürmen. Die TV-Übertragung im Finale und Halbfinale überblendete die Proteste zum zweiten Mal nach 2024 mit künstlichem Applaus – eine Manipulation, die in den sozialen Medien wieder ziemlich schnell aufflog.
Die Polizei in Basel musste um die St. Jakobshalle und in der Stadt eingreifen: Tränengas, Wasserwerfer, mindestens ein verletztes israelisches Crew-Mitglied, das mit Farbe beworfen wurde.
Vor den Auftritten Israels forderten 72 frühere ESC-Teilnehmer in Irland in einem offenen Brief Israels Ausschluss vom Wettbewerb 2025, wegen der politischen Lage im nahen Osten.
Auch in Spanien gab es klare Worte: Der Sender RTVE blendete zu Beginn des ESC-Finales eine Botschaft „für Frieden und Gerechtigkeit für Palästina“ ein – die EBU drohte prompt mit Sanktionen.
Die Krönung: Israel gewann das Publikumsvoting mit 297 Punkten, trotz der massiven Kritik – während die Jurys nur 60 Punkte vergaben. Das Misstrauen war plötzlich spürbar: Wer stimmt hier eigentlich wie ab – und warum?
Die Debatte über Neutralität, Einflussnahme und politische Botschaften beim ESC dürfte damit erst so richtig Fahrt aufgenommen haben.
Zwischen Applaus und Alarm – Wie geht’s weiter mit dem ESC?
Der Eurovision Song Contest 2025 war musikalisch reich, emotional aufgeladen – und wieder einmal politisch hochbrisant. Dabei wird der Wettbewerb als 2unpolitisch“ bezeichnet und laut des Veranstalters EBU soll dass eigentlich auch so bleiben. Allerdings kann man die Realität, Proteste und Buhrufe nicht einfach ausblenden. Hier bedarf es mehr als nur Patchwork. Der Wettbewerb braucht neue, klare Regeln, was politische Aktivitäten in der Welt angeht, so scharf und ungerecht sie auch sein mögen. Mit einer Doppelmoral kommt man hier nicht weiter.
Der Sieg Österreichs ist verdient, keine Frage. Doch die Schlagzeilen wurden vom Protest gegen Israel, Null-Punkte-Schocks beim Televoting und beinahe Eskalationen in der Halle dominiert.
Die EBU steht definitiv vor einem Dilemma: Soll der ESC ein unpolitisches Musikfest bleiben – oder ist er längst Teil des geopolitischen Schachbretts und wird ausgenutzt?
Klar ist: Für 2026 und den 70. ESC wird ein bloßes „Weiter so“ nicht reichen. Die Auswahlregeln, das Votingsystem, die Kommunikationsstrategien, das Unpolitische – alles das steht auf dem Prüfstand. Der nächste Austragungsort wird eine robuste Debattenkultur brauchen, die vorher stattfinden muss.
Denn eines ist sicher: Die Welt schaut zu und wählt – und nicht immer nur wegen der Songs.
Geschrieben von: stanley.dost
Ähnliche Beiträge
Aus für den Kulturpass: Jugendliche kritisieren Signal gegen Chancengleichheit
today24. September 2025

Copyright 2025 by HörfunkBund e. V.



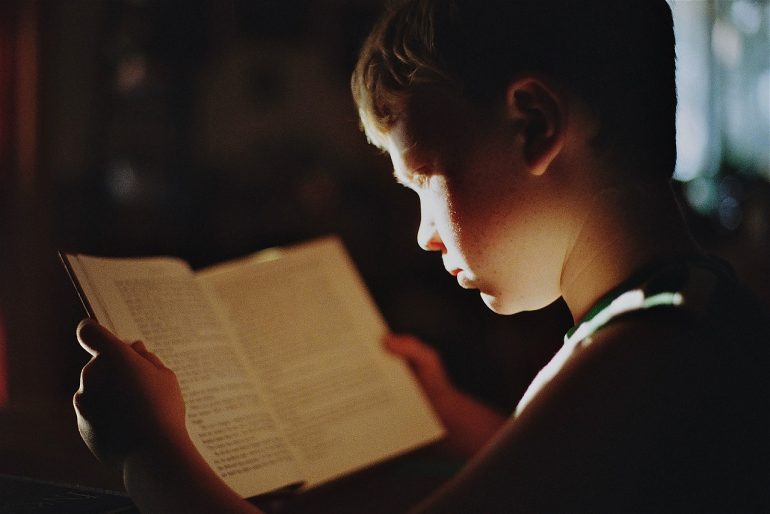

Beitrags-Kommentare (0)